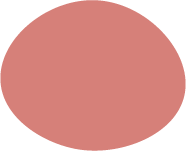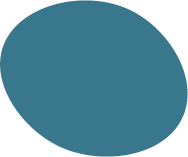Stuttgart: Heimat(en) schaffa: Unsichtbare Gefühle – Sichtbare Realitäten“
ist eine Kooperation von WERTansich(t), dem StadtPalais – Museum für Stuttgart, der Black Community Foundation Stuttgart e.V. , und dem Deutsch-Kurdischen Forum e.V.. Es erkundet den vielschichtigen Begriff von Heimat(en) in einer pluralen, postmigrantischen Stadtgesellschaft durch eine Reihe partizipativer Workshops mit diversen Communities aus Stuttgart.
Das heimaten Netzwerk ist eine Initiative von Haus der Kulturen der Welt im Rahmen von heimaten, gefördert durch Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
https://heimaten.hkw.de/
Eröffnungsveranstaltung: Freitag, 26.9.2025 – 18:30 bis 21:00 Uhr im StadtPalais Museum für Stuttgart
„Heimat(en) schaffa: Unsichtbare Gefühle – Sichtbare Realitäten“
das Festival der pluralen Demokratie: Lesungen, Workshops- und Begegnungsräume mit Stuttgarter Communities
Im Zentrum stehen künstlerisch-gesellschaftliche Begegnungen, bei denen Erfahrungen, Perspektiven und Widersprüche rund um Heimat interaktiv verhandelt werden. Mit methodischer Vielfalt – von Forumtheater, Betzavta und Biografiearbeit bis zu künstlerischen Text- und Sprachexperimenten – schaffen die Workshops Räume für Austausch, Selbstreflexion und kollektive Aushandlung. Jede Veranstaltung bringt mindestens zwei Community-Projekte zusammen, die ihre Sichtweisen auf Heimat(en) einbringen: emotional, gesellschaftlich, politisch.
Die Koordinierungsstelle Erinnerungskultur der Stadt Stuttgart begleitet das Projekt als impulsgebender Partner im Kontext pluraler Erinnerungskultur.
„Heimat(en) schaffa“ begreift Heimat nicht als statischen Ort, sondern als verhandelbare Erfahrung. Die Workshops eröffnen niedrigschwellige, erlebnisorientierte Räume für demokratisches Handeln, empowern marginalisierte Perspektiven und laden dazu ein, Heimat(en) als geteilte Zukunft aktiv mitzugestalten.
Kooperationspartner und Förderer: WERTansich(t) veranstaltet das Heimaten-Festival in Kooperation mit StadtPalais Stuttgart, Black Community Foundation Stuttgart e.V., Deutsch-Kurdisches Forum e.V., Koordinierungsstelle Erinnerungskultur der Stadt Stuttgart.
Literaturhaus Stuttgart, Lernort Geschichte, Stadt Stuttgart Abteilung Integrationspolitik, DGB Stuttgart, IG-Metall und Verdi Stuttgart
Das Projekt ist konzipiert vom HKW und den Ko-Kuratoren Ibou Diop und Max Czollek und wird von einem Netzwerk von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Kulturinstitutionen in den sechzehn deutschen Bundesländern sowie in Österreich und der Schweiz getragen. Für Stuttgart stellen Vatan Ukaj, Avra Emin und Faisal Osman das Kurations-Team.
https://heimaten.hkw.de/
Eröffnungsveranstaltung: Freitag, 26.9.2025 – 18:30 bis 21:00 Uhr im StadtPalais Museum für Stuttgart
Die Eröffnungsveranstaltung von Heimat(en) schaffa lädt zu einer vielstimmigen, interaktiven Auseinandersetzung mit dem Begriff „Heimat“ ein. In einem offenen Dialog mit Vertreter*innen aus Kultur, Politik und Zivilgesellschaft werden Gefühle, Narrative und politische Forderungen sichtbar gemacht. Der gemeinsame Austausch wird durch eine Dialog-orientierte Gestaltung des Raums gefördert, es gibt moderierte Gesprächsrunden mit QR-Codes für die Beteiligung des Publikums sowie künstlerische Impulse.
Das Projekt „Heimat(en) schaffa: Unsichtbare Gefühle – Sichtbare Realitäten“ erkundet den vielschichtigen Begriff von Heimat(en) in einer pluralen, postmigrantischen Stadtgesellschaft durch eine Reihe partizipativer Workshops mit diversen Communities aus Stuttgart. Im Zentrum stehen künstlerisch-gesellschaftliche Begegnungen, bei denen Erfahrungen, Perspektiven und Widersprüche rund um Heimat interaktiv verhandelt werden. Mit methodischer Vielfalt – von Forumtheater, Betzavta und Biografiearbeit bis zu künstlerischen Text- und Sprachexperimenten – schaffen die Workshops Räume für Austausch, Selbstreflexion und kollektive Aushandlung. Jede Veranstaltung bringt mindestens zwei Community-Projekte zusammen, die ihre Sichtweisen auf Heimat(en) einbringen: emotional, gesellschaftlich, politisch. „Heimat(en) schaffa“ begreift Heimat nicht als statischen Ort, sondern als verhandelbare Erfahrung.
Performance & Workshop 3: Situation Room - Wir sammeln Erinnerungen an eine (andere) Zukunft - mit Muhammet Ali Baş am Do, 13.11. 18:30 - 21:00 Uhr im StadtPalais Stuttgart
Kooperation mit Koordinierungsstelle Erinnerungskultur Stuttgart
Unsere Zukunft ist in Gefahr, und oft fühlt es sich so an, als wäre es bereits zu spät, sich für irgendetwas einzusetzen. Noch dazu wird mit Blick auf unsere krisenüberfüllte Welt ziemlich deutlich: die Gegenwart ist durchzogen vom menschlichen Versagen. Während selbst in widerständigen Räumen oft wiederholt wird, dass alles niemals gut für alle sein wird, offenbaren aktuelle politische Entwicklungen, insbesondere das Erstarken des Rechtsextremismus und Autoritarismus, dass alles schlecht bleiben und sogar noch schlechter werden kann.
Angesichts dieser Notlage wird der „Situation Room“, im Rahmen vom HeimatEN-Projekt in Kooperation mit der Koordinierungsstelle Erinnerungskultur der Stadt Stuttgart, von Kurator und Sprachkünstler Muhammet Ali Baş einberufen. Der Situation Room ist eine performative Versammlung von Künstler*innen, Visionär*innen und Besucher*innen, die sich mit Mitteln der spekulativen Science-Fiction und Dank des Erinnerungsboosters „Mentha Memoralis“ an andere Zukünfte erinnern, die Noch-Nicht passiert sind, aber sich erinnern lassen, als wären sie bereits geschehen. So entstehen kollektive Erinnerungen, die als Narrativen der Krisenüberwindung gegenwärtige Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und Hoffnung für eine fürsorgliche und gerechte Zukunft spenden.
Erinnerungssammler – Muhammet Ali Baş.
Er studierte Sprachkunst und Ausstellungstheorie und -praxis an der Universität für angewandte Kunst Wien. Als Sprachkünstler arbeitet er interdisziplinär zu Themen wie Sprache, Erinnerung, Repräsentation und Rassismus. In unterschiedlichen Communityprojekten fördert er Emporwerment und Selbstwirksamkeit durch die Vermittlung von künstlerischen und literarischen Praxen und der Auseinandersetzung mit Geschichte, Gegenwart und Identität. Zuletzt arbeitete er als Kurator und Vermittler für die Tangente St. Pölten, Festival für Gegenwartskultur sowie als Kulturvermittler im Weltmuseum Wien. Der Situation Room entstand im Rahmen des Jahresprogramms „through the dark“ des Volkskundemuseum Wien.
Erinnerungsgeber*innen: Lídia Chaves, Ülkü Süngün und Furkan Yüksel.
Lídia Chaves ist eine brasilianische Künstlerin aus Minas Gerais und lebt derzeit in Stuttgart. Sie hat Architektur an der Universität Stuttgart studiert, und ihre Praxis verbindet Architektur, Sprache, Erinnerung und das Erzählen von Geschichten im öffentlichen Raum. Ihre laufende Forschung zu kolonialen Spuren in Stuttgart hat zu öffentlichen Projekten wie NEBEN DEM KAKAOFELD (2023) und bei Nills (2024) sowie zu weiteren Kooperationen mit dem Kulturamt Stuttgart und der Stelle Erinnerungskultur geführt.
Ülkü Süngün ist bildende Künstlerin, forschende Aktivistin und artist curator und lebt und arbeitet in Stuttgart. Mit ihrer künstlerischen Forschung untersucht sie Migrations- und Identitätspolitiken ebenso wie Erinnerung. Hierfür nutzt sie Medien wie Fotografie, Video, Performance Art, sowie Installation und Bildhauerei. Mit dem 2017 gegründeten Institut für Künstlerische Migrationsforschung macht sie diese Praxis strukturell sichtbar. 2013 wurde das von ihr entworfene Denkmal für deportierte Jüd:innen am Killesbergpark in Stuttgart realisiert.
Furkan Yüksel ist freier Referent in der historisch-politischen Bildungsarbeit. In seiner Arbeit thematisierte er hauptsächlich Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und Erinnerungskulturen. Seit 2021 versteht er sich als Botschafter für das Stuttgarter Projekt Schalom und Salam.
Workshop 6: Lesung und Gespräch am Montag 8.12. 19:30 Uhr im Literaturhaus Stuttgart - Tradwifes auf Heimatsuche: Die Geschichte einer Radikalisierung mit Hannah Lühmann und Mithu Sanyal
Moderation: Vatan Ukaj
Das vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin initiierte bundesweite „heimaten Festival für plurale Demokratie“ initiiert künstlerisch-gesellschaftliche Begegnungen mit Station auch in Stuttgart: Im Literaturhaus zu Gast ist die Journalistin und Schriftstellerin Hannah Lühmann mit ihrem neuen Roman „Heimat“, die Geschichte der Radikalisierung einer liberalen jungen, großstädtisch geprägten Mutter hin zur „Tradwife“. Tradwife ruft einen Weiblichkeitsbegriff auf, der seit den 2020er Jahren durch Social-Media-Influencerinnen als neuer Lifestyle präsentiert und propagiert wird und die Erfüllung von Frauen im Haushalt, der Kindererziehung und der Unterordnung unter den Mann sieht, oftmals unterfüttert von rechten, rassistischen Ideologien. Mit Hannah Lühman ins Gespräch kommt die Schriftstellerin und Wissenschaftlerin Mithu Sanyal. Sie untersucht sowohl in ihrer Literatur aber auch in ihren wissenschaftlichen Texten klug und originell Weiblichkeitsbilder, Formen sexualisierter Gewalt, Alltagsrassismus und Postkolonialismus und hat u.a. auch einen Beitrag für den 2019 erschienenen Sammelband „Eure Heimat ist unser Alptraum“ verfasst – eine kritische Gegenwartsanalyse aus postmigrantischer Perspektive. Ins Gespräch gebracht durch Vatan Ukaj von WERTansich(t) diskutieren die Autorinnen über Heimatkonzepte, Geschlechterbilder, Sehnsucht und Illusion.
Eine Initiative vom Haus der Kulturen der Welt im Rahmen von „heimaten“, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien; eine Kooperation von WERTansich(t), StadtPalais Stuttgart, Black Community Foundation Stuttgart e.V., Deutsch-Kurdisches Forum e.V. und Literaturhaus Stuttgart.
Tickets unter www.literaturhaus-stuttgart.de
Ort: Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstraße 4, 70174 Stuttgart
Abschlussevent „Heimat(en) gestalten: Ein Fest der Perspektiven und Ergebnisse“11.12.2025 um 18:30-21:00 Uhr im StadtPalais Stuttgart
Die Abschlussveranstaltung von „Heimat(en) schaffa: Unsichtbare Gefühle – Sichtbare Realitäten“ bildet den feierlichen und zugleich diskursiven Schlusspunkt eines Projekts, das in den vergangenen Monaten Raum geschaffen hat für persönliche und kollektive Erkundungen von Heimat(en) in Stuttgart.
An diesem Tag kommen die vielfältigen Ebenen des Projekts zusammen:
→ Heimat als innere, emotionale Erfahrung: In einer Panelrunde und begleitenden Mini-Ausstellung werden künstlerische und biografische Arbeiten präsentiert, die zeigen, wie Menschen in Stuttgart Heimat fühlen, hinterfragen oder neu definieren.
→ Heimat als gelebte Praxis: An Ständen verschiedener Projekt-Communities und Initiativen wird erfahrbar, wie Heimat(en) im Alltag gestaltet werden – als Empowerment-Räume, als politische Handlungsebene und als gelebte Vielfalt.
→ Heimat als gesellschaftliche Wahrnehmung: Auf der Bühne bringen künstlerische Beiträge, performative Elemente und Reflexionen in Szene, wie Heimat(en) im Spiegel der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen wird – und wie Communities sich in diesem Bild selbst positionieren oder neue Narrative setzen.
laden dazu ein, Heimat(en) als geteilte Zukunft aktiv mitzugestalten.
Heidelberg
Heimat(en) der Zukunft
Eine spielerische Erkundungsreise mit Lego-Serious-Play
Sa 20.09.25 / 13:00 / Zentrale
Einlass 13:00
Unbestuhlt im Zentrale
Workshop 1: Do, 09.10.2025 - 18:30 - 21:00 Uhr, Interaktiver Workshop & Lesung mit Avra Emin und Sevdije Demaj, moderiert von Vatan Ukaj im StadtPalais Stuttgart
Der Workshop, der Literatur, Biografiearbeit und interaktive Methoden verbindet.
Zwei Autorinnen –
Avra Emin (Erinnerungen. Life is a Story – story.one) und
Sevdije Boshtrakaj-Demaj (Nachdenklich – Poetische Selbstreflexionen) – eröffnen den Raum mit Lesungen ausgewählter Passagen aus ihren Büchern. Ihre Texte berühren Themen wie Migration, Zugehörigkeit, Verlust, Sehnsucht, Empowerment und die Suche nach Heimat(en).
Die Lesungen bilden den Ausgangspunkt für einen interaktiven Workshop, in dem die Teilnehmenden ihre eigenen Erfahrungen, Fragen und Widersprüche rund um Heimat(en) sichtbar machen. Moderiert von Vatan Ukaj entstehen durch biografisch-künstlerische Methoden, Gesprächsimpulse und partizipative Übungen Räume für Selbstreflexion, Dialog und kollektive Aushandlung.
Ziele des Workshops
- Sichtbarmachen: Unsichtbare Gefühle und persönliche Erfahrungen zu Heimat(en) werden durch Literatur und Austausch erlebbar.
- Reflektieren & Teilen: Teilnehmende setzen sich mit eigenen Perspektiven und Geschichten auseinander und treten mit anderen Communities in Dialog.
- Gestalten: Heimat(en) wird als verhandelbarer, demokratischer Erfahrungsraum verstanden – mit Möglichkeiten, gemeinsame Zukunft zu denken und zu gestalten.
Ablauf
- Begrüßung & Einführung (Moderation: Vatan Ukaj)
- Lesung aus den Werken von Avra Emin und Sevdije Boshtrakaj-Demaj
- Dialog-Impulse: Erste Reflexionsrunde im Plenum – Welche Bilder, Gefühle, Fragen entstehen?
- Interaktive Workshopphase:
- Biografische Mini-Übungen & Schreibimpulse
- Kleingruppenarbeit mit Gesprächs- und Austauschräumen
- Kollektive Sammlung von Begriffen, Erfahrungen und Widersprüchen zu Heimat(en)
- Gemeinsame Verdichtung: Austausch im Plenum, Sichtbarmachen der entstandenen Ideen und Gedanken
- Abschlussrunde & Ausblick: Heimat(en) als geteilte, offene Zukunft
„Heimat(en) schaffa“ begreift Heimat nicht als statischen Ort, sondern als verhandelbare Erfahrung. Die Workshops eröffnen niedrigschwellige, erlebnisorientierte Räume für demokratisches Handeln, empowern marginalisierte Perspektiven und laden dazu ein, Heimat(en) als geteilte Zukunft aktiv mitzugestalten.
Workshop 2: Do, 30.10. 18:30 - 21:00 Uhr, Heimat fühlen – emotionale Zustände von Zugehörigkeit sichtbar machen mit Avra Emin im StadtPalais Stuttgart
Der Workshop widmet sich der Frage, wie Heimat auf der inneren Ebene empfunden und verarbeitet wird.
Im Mittelpunkt steht nicht ein geografischer oder kultureller Heimatbegriff, sondern die emotionale Erfahrung von Zugehörigkeit, Geborgenheit, Entfremdung, Exklusion oder Heimatlosigkeit.
Was bedeutet es, sich zugehörig zu fühlen – oder eben nicht?
Der Workshop „Heimat fühlen“ lädt dazu ein, Heimat nicht als Ort zu verstehen, sondern als emotionale Erfahrung: als Zustand von Sicherheit, Resonanz, Verlorenheit oder innerem Ankommen. Ziel ist es, individuelle wie kollektive Heimatgefühle sichtbar zu machen – jenseits von Herkunft, Pass oder Zugehörigkeitskategorien.
Der Workshop richtet sich ausdrücklich auch an Vereine, Initiativen und Gruppen, die sich mit Identität, Community, Empowerment oder gesellschaftlichem Miteinander beschäftigen. Er bietet einen Raum für Austausch, künstlerische Auseinandersetzung und neue Perspektiven auf das Thema Heimat – als etwas, das alle Menschen betrifft.
Durch biografische Impulse, kreative Methoden und offene Dialoge erkunden die Teilnehmenden individuelle Zustände von „Heimat“ – auch solche, die widersprüchlich, fragmentiert oder schwer greifbar sind. Dabei entstehen persönliche Ausdrucksformen: Erinnerungsobjekte, visuelle Fragmente oder intuitive Installationen, die als emotionale Spur gelesen werden können.
Der Workshop eignet sich auch für Gruppen, die sich mit Themen wie queere Identität, soziale Verwurzelung, psychisches Wohlbefinden, Erinnerungskultur oder Exklusion befassen – und schafft einen Resonanzraum für vielfältige Erfahrungen von „Heimat“.
Zielgruppe:
Vereine, Initiativen, Community-Projekte und Einzelpersonen mit Interesse an emotionaler Selbstverortung, künstlerischer Ausdrucksform und kollektiver Reflexion.
Workshop 4:Dialog-Session: „Demokratie in HEIMAT-Zwischen-Räume(n)“ – Kommunikation zwischen (er)Inne(r)n, Außen und der Verantwortung dazwischen. Do, 27.11. 18:30 - 21:00 Uhr im StadtPalais Stuttgart
Impulse durch Prof. Dr. Frederek Musall, Mergime Mahmutaj und Vatan Ukaj (Moderation)
Diese Veranstaltung ist durch die Stadt Stuttgart gefördert, Abteilung Integrationspolitik.
In einem interaktiven Dialogformat untersuchen wir das Spannungsfeld zwischen individuellen Innenwelten, gesellschaftlichen Zuschreibungen und der Verantwortung, die in diesem Dazwischen entsteht. Heimat wird dabei nicht als statischer Ort verstanden, sondern als dynamischer Raum kommunikativer Aushandlungen – zwischen Selbst- und Fremdbildern, zwischen Zugehörigkeit und Ausschluss, zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit.
Impulse aus drei Perspektiven eröffnen den Raum:
Prof. Dr. Frederek Musall
Judaist, Religionswissenschaftler und Mitbegründer der Jüdisch-Muslimischen Kulturtage Heidelberg. Er eröffnet einen Denkraum über demokratische Verantwortung, kulturelle Pluralität und Kommunikationsethik im Spannungsfeld von Heimat, Religion und Erinnerung.
Mergime Mahmutaj
Mitarbeiterin der Stadt Stuttgart, zuständig für den Aufbau des neuen Hauses der Kulturen. Aus ihrer Perspektive berichtet sie über praktische Herausforderungen, Ressourcen und Erkenntnisse aus der community-basierten Partizipationsarbeit in einer vielstimmigen Stadtgesellschaft.
Vatan Ukaj
Demokratiecoach, Moderator und Konflikttrainer. Mit einem Fokus auf demokratische Kommunikation und intersektionale Perspektiven spricht er über Zugänge zu Kommunikation in ambivalenten Realitäten: Wie gelingt es, Sprache und Räume so zu gestalten, dass sie demokratische Teilhabe ermöglichen – und nicht ausschließen?
Ablauf (modular):
- Drei Impulse à ca. 15 Minuten
- Interaktive Raumpositionierung mit dem Publikum
- Moderierte Gesprächsrunde mit den Referierenden
- Gemeinsame Sammlung von Ideen für pluralitätsfähige Kommunikationsräume in der Stadt
Zielgruppe:
Interessierte Menschen, Kultur, Politik, Verwaltung, Communities, Bildungs- und Erinnerungsarbeit
Workshop 5: Heimat: Dein gelebtes Ich – und wie es gesehen wird am Do, 04.12. 18:30 - 21:00 Uhr im StadtPalais mit Faisal Osman
Dieser Workshop widmet sich der Frage, wie man die ganz persönliche Definition von Heimat im Alltag lebt und erfahrbar macht
Er geht über theoretische Konzepte hinaus und beleuchtet, wie Heimat als aktive Praxis aussieht: Was bedeutet es für einen selbst, Heimat zu leben? Welche Handlungen, Rituale oder Räume schaffen für einen Zugehörigkeit, Sicherheit oder Verbundenheit? Ein zentraler Aspekt ist die „Anleitung, wie man man selbst ist“ im Kontext von Heimat und wie diese gelebte Individualität von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Wir erkunden, wie individuelle Lebensrealitäten, Erfahrungen und Identitäten die gelebte Heimat prägen und wie man dabei die eigene Sichtbarkeit gestalten kann. Es geht darum, nicht nur zu erfahren, was Heimat bedeutet, sondern auch darum, wie man in diesem Kontext gesehen werden möchte und wie sich dies mit den Blicken anderer überlagert oder unterscheidet. Die im Workshop erarbeiteten Ergebnisse werden in Form von Ständen auf der Abschlussveranstaltung präsentiert. Diese Stände bilden die Grundlage für eine gemeinsame „Broschüre: Wer wir sind und was wir wollen“, die die Vielfalt der gelebten Heimaten und ihre gesellschaftliche Bedeutung sichtbar macht. Der Workshop bietet Raum für Reflexion, Austausch und die künstlerische Auseinandersetzung mit der eigenen Positionierung im gesamtgesellschaftlichen Bild von Heimat.
Zielgruppe:
Dieser Workshop richtet sich an alle, die ihre gelebte Heimat reflektieren, ihre persönliche Definition sichtbar machen und sich mit der Wahrnehmung durch andere auseinandersetzen möchten. Er ist offen für Einzelpersonen sowie Vertreter von Vereinen, Initiativen und Gruppen, die sich mit Identität, Community, Empowerment oder gesellschaftlichem Miteinander beschäftigen.
Workshop 7: Heimat(en) der Unsichtbaren – Ein Stadtspaziergang durch Erinnerungen und Realitäten in Stuttgartam 23.10.2025 um 17:30 Uhr, Treffpunkt am Hbf Bad Cannstatt mit Lucija Marosević und Vatan Ukaj
Lernort Geschichte Stuttgart, DGB Region Stuttgart, IG-Metall Stuttgart und Verdi Stuttgart
Zwischen Wirtschaftswunder und Willkommenskultur: In der kollektiven Erinnerung an die sogenannte Gastarbeiter\:innen-Ära klafft bis heute eine Leerstelle. Millionen Menschen aus Ländern wie Italien, Griechenland, der Türkei, Ex-Jugoslawien, Spanien oder Marokko haben zwischen 1955 und 1973 mit ihrem Leben und Arbeiten unsere Städte mitgeprägt – auch Stuttgart. Doch die damit verbundenen Geschichten, Erfahrungen und Spuren sind in der offiziellen Erinnerungskultur bis heute oft unsichtbar geblieben.
Im Rahmen des Projekts *„Heimat(en) schaffa: Unsichtbare Gefühle – Sichtbare Realitäten“* machen wir diese Geschichten gemeinsam sichtbar: Bei einem partizipativen Stadtspaziergang durch die Bad Cannstatter Innenstadt erkunden wir Orte, die für migrantische Communities bedeutsam waren – und sind. Der Workshop lädt dazu ein, Fragen von Zugehörigkeit, Ausschluss, Widerstand und Erinnerung im urbanen Raum zu verhandeln.
Gemeinsam mit Teilnehmenden aus verschiedenen Stuttgarter Communities erkunden wir, wie das Erleben von „Heimat“ mit Orten, Emotionen und (Un-)Sichtbarkeit verbunden ist: Welche Erinnerungen tragen wir an Bahnhöfe, Wohnheime, Treffpunkte, Vereinsräume oder Betriebe? Welche emotionalen Zustände wie Hoffnung, Entfremdung, Stolz oder Schmerz sind an diese Orte geknüpft? Und welche Narrative über „deutsche“ Erinnerungskultur werden dadurch herausgefordert?
Ziele des Workshops:
* Sichtbarmachung migrantischer Perspektiven auf Heimat(en) im öffentlichen Raum
* Reflexion über emotionale Zustände von Zugehörigkeit und Ausschluss
* Auseinandersetzung mit pluraler Erinnerungskultur im Kontext von Migration, Rassismus und struktureller Unsichtbarkeit
* Empowerment durch kollektives Erinnern und Erzählen
Methoden: Kombiniert werden dialogische Stadtbegehung, biografische Impulse, kollektives Erzählen, Mikro-Performances und Audio-Dokumentation. Die Teilnehmenden sind eingeladen, Erinnerungsfragmente zu teilen, Orte neu zu lesen und eigene Narrative in den Stadtraum einzuschreiben.
Zielgruppe:
alle Interessierten Menschen, Menschen aus migrantischen Communities, Initiativen, Erinnerungsarbeiter\:innen, Stadtbewohner\:innen, Jugendliche und Erwachsene mit Interesse an pluraler Erinnerungskultur, Stadtgeschichte und postmigrantischen Perspektiven.
Dauer:
ca. 2,5 Stunden
Leitung:
Führung durch Lucija Marosević, Lernort Geschichte Stuttgart
Moderation Vatan Ukaj, WERTansich(t)



Das heimaten Netzwerk ist eine Initiative von Haus der Kulturen der Welt im Rahmen von heimaten, gefördert durch Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.